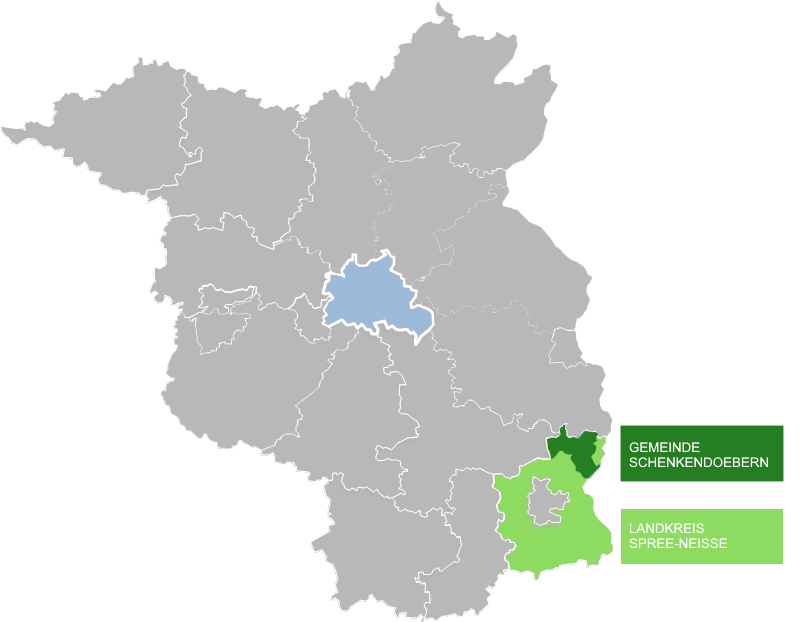Einrichtung eines Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen
1. Kultur als Rückgrat unserer Gesellschaft
Kunst und Kultur sind elementare Bestandteile unserer gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Lebenswelt. Sie sind soziales Bindeglied, ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe und Zusammenhalt und tragen zur Wertschöpfung unserer Volkswirtschaft bei. Eine Gesellschaft kann ihre produktiven Kräfte und ihren inneren Zusammenhalt langfristig nur sichern, wenn sie über ein vielfältiges und lebendiges Kulturleben verfügt.
Die Bundesrepublik Deutschland hat ein reiches kulturelles Leben. 150.000 Kulturveranstaltungen – Konzerte, Festivals, Opern, Tanz, Film, Theater, Musicals, Comedy, Ausstellungen, Lesungen – finden jährlich in Deutschland statt; dazu zählen 5 Millionen Besuche von Konzerten der 128 öffentlichen Konzert- und Theaterorchester und 26 Millionen Besuche in einer der 800 Theaterbühnen in Deutschland. Das kulturelle Leben ist vielfältig und bunt. Es bildet damit die Gesellschaft in der Breite ihrer individuellen Lebensgestaltungen ab.
1,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger arbeiten in Kulturberufen – unmittelbar, zum Beispiel als Musikerinnen und Musiker, Bühnenbildnerinnen und Bühnenbilder, oder Veranstalterinnen und Veranstalter, oder mittelbar in der Logistik, Technik oder anderen angeschlossenen Gewerken. Damit erfasst Kultur als Wirtschafts- und Arbeitsfaktor zahlreiche Berufsgruppen, die untereinander vielfältig vernetzt sind. Umgekehrt heißt das auch: Ein darniederliegendes Kulturleben schwächt nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt und beschneidet jeden einzelnen Menschen in seiner individuellen Lebensgestaltung und seinen Gewohnheiten, sondern bedroht akut auch die Existenz vieler Kulturschaffender und Kultureinrichtungen.
Mit Beginn der Corona-Pandemie ist das kulturelle Leben dieses Landes zum Erliegen gekommen. Dieser Stillstand des kulturellen Veranstaltungsbetriebs, der seit über einem Jahr bis heute andauert, hinterlässt tiefe wirtschaftliche Spuren. Der andauernde Einnahmeausfall hat für viele Kulturschaffende nicht nur gravierende Folgen und existenzbedrohende Dimensionen. Er raubt vielen von ihnen auch den Mut und das wirtschaftliche Fundament, um sich auf eine Zeit der Wiedereröffnung des öffentlichen Lebens einzustellen und Planungen für zukünftige kulturelle Angebote zu wagen.
2. Die Ratio für einen Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen
Vor diesem Hintergrund soll – soweit die pandemiebedingten Beschränkungen es zulassen – dem kulturellen Sektor zu seiner alten Lebendigkeit verholfen werden. Um einen schnellen Wiederbeginn des kulturellen Lebens und eine Rückkehr zur Normalität für Kulturschaffende zu ermöglichen, ist die rasche Wiederaufnahme von Kulturveranstaltungen von hoher Dringlichkeit. Diese Aufgabe kann der Kultursektor nicht allein bewältigen. Auch nach einem Neustart werden Kulturveranstaltungen hygienischen Restriktionen und Beschränkungen in ihren Besucherkapazitäten ebenso wie der Gefahr etwaiger erneuter pandemiebedingter Restriktionen unterworfen sein.
Die damit verbundene andauernde Unsicherheit und die herausgehobene Bedeutung von Kunst und Kultur machen es erforderlich, dass der Staat Kulturschaffende unterstützt. Die dargestellten Ungewissheiten und ökonomischen Zwänge, sowohl in Planung als auch in der Durchführung der Veranstaltungen erfordern eine finanzielle Unterstützung und Absicherung. Angesichts der historischen Ausnahmesituation der Corona-Pandemie ist es angezeigt, dass der Bund sich neben Ländern und Kommunen an diesem kulturpolitisch notwendigen finanziellen Kraftakt beteiligt.
Schon seit Beginn der Pandemie hat die Bundesregierung dafür erhebliche Finanzmittel bereitgestellt. Das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) betreute Programm NEUSTART KULTUR sorgt mit 2 Milliarden Euro dafür, die kulturelle Infrastruktur hierzulande zu stützen und in der Krise – insbesondere während der gravierenden Schließungsphasen – zu erhalten. Auch unterstützt NEUSTART KULTUR die aktive Kulturproduktion und das Wiederanlaufen von Kulturveranstaltungen. Weiteres wichtiges Hilfsinstrument der Bundesregierung für die Kulturbranche ist die Überbrückungshilfe III, hier nicht zuletzt der Baustein der Neustarthilfe für Solo-Selbständige. Als dritte Säule wird nunmehr ein spezieller Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen eingerichtet. Diesen Sonderfonds haben Bundesregierung und die Kulturministerinnen und Kulturminister der Länder gemeinsam konzipiert. Er wird gemeinsam vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) und von der BKM verantwortet. Die Mittel in Höhe von 2,5 Milliarden Euro werden der BKM zur Bewirtschaftung zugewiesen. Diese übernimmt auch den Vorsitz in einem Lenkungsausschuss, der die Umsetzung des Programms zwischen Bund und Ländern koordiniert.
Der Sonderfonds besteht aus zwei Bausteinen: Eine Wirtschaftlichkeitshilfe soll dabei helfen, kleinere Veranstaltungen unter Corona-bedingten Einschränkungen wirtschaftlich realisierbar zu machen. Durch eine Bezuschussung der Einnahmen aus Ticketverkäufen werden so die wirtschaftlichen Risiken reduziert und die Planbarkeit und Durchführbarkeit von Veranstaltungen verbessert. Daneben stellt der
Sonderfonds eine Ausfallabsicherung bereit, die größeren Kulturveranstaltungen dadurch Planungssicherheit verschafft, dass im Falle Corona-bedingter Absagen, Teilabsagen oder Verschiebungen von Veranstaltungen ein Teil der Ausfallkosten durch den Fonds übernommen wird.
Der Sonderfonds des Bundes wird über die Kulturministerien der Länder umgesetzt. Die Anträge werden über sie gestellt. Die Länder prüfen die Anträge und zahlen die Mittel aus. Der Sonderfonds ist auf Kulturveranstaltungen begrenzt und betreibt damit keine allgemeine Wirtschaftsförderung anderweitiger Veranstaltungen. Aufgrund des existierenden beihilferechtlichen Ausnahmeregimes für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes im Rahmen der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) gibt es einen etablierten Rechtsrahmen für derartige Beihilfen. Die Leistungen werden als Billigkeitsleistungen gezahlt.
Die Registrierung von Veranstaltungen ist ab dem 15. Juni 2021 über nachfolgende Webseite möglich. Dort sind auch umfassende FAQ eingestellt, einschließlich einer Übersicht, welche Veranstaltungen gefördert werden können.
Webseite mit Registrierungsplattform des Sonderfonds:
www.sonderfonds-kulturveranstaltungen.de
Beratungshotline für Antragstellende:
0800 6648430
3. Wirtschaftlichkeitshilfe und Ausfallabsicherung
Beide Elemente des Sonderfonds sollen Kulturveranstaltungen fördern. Somit geht es um Veranstaltungen wie Konzerte, Festivals, Opern, Tanz, Film, Theater, Musicals, Comedy, Lesungen und andere Kulturveranstaltungen – für die Einordnung als Kulturveranstaltungen sind die Rahmenbedingungen von Art. 53 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) maßgeblich. Präzisiert wird dies durch eine Positiv- bzw. Negativliste, anhand derer die Förderwürdigkeit einer Kulturveranstaltung zu identifizieren ist. Die Positivliste soll für Antragsstellerinnen und Antragsteller ein möglichst hohes Maß an Transparenz hinsichtlich der Antragsberechtigung ihrer Veranstaltung ermöglichen und gleichzeitig sicherstellen, dass es sich bei den begünstigten Veranstaltungen um künstlerische und kulturelle Darbietungen und Aktivitäten handelt. Zweifelsfragen sollen über die Beratungshotline der Länder geklärt werden können.
Wirtschaftlichkeitshilfe
Nach den nunmehr Schritt für Schritt erfolgenden Lockerungen der Beschränkungen für das öffentliche Leben soll die Wirtschaftlichkeitshilfe kleinere Kulturveranstaltungen fördern, die ab dem 1. Juli 2021 durchgeführt werden und an denen unter Beachtung Corona-bedingter Hygienebestimmungen bis zu 500 Besucherinnen und Besucher teilnehmen. Ab dem 1. August 2021 werden Veranstaltungen mit bis zu 2.000 Besucherinnen und Besuchern gefördert. Weitere Fördervoraussetzung ist, dass diese Veranstaltungen aufgrund der Bestimmungen mit maximal 80 Prozent ihrer Kapazität durchgeführt werden können. Die dadurch erzwungenen geringeren Ticketeinnahmen würden viele Veranstaltungen ohne Bezuschussung unrentabel machen – sie würden somit gar nicht erst stattfinden. Die Wirtschaftlichkeitshilfe soll diese Reduzierung der Einnahmen teilweise ausgleichen, um im Fall einer Finanzierungslücke die Wirtschaftlichkeit von Veranstaltungen herzustellen.
Konkret soll der Sonderfonds pro Veranstaltung die Ticketeinnahmen aus den bis zu 500 verkauften Tickets im Juli 2021 bzw. den ersten 1.000 verkauften Tickets ab August 2021 um 100 Prozent bezuschussen. Durch eine individuelle Höchstgrenze wird sichergestellt, dass die Förderung nicht höher ist als die auftretende Finanzierungslücke zwischen veranstaltungsbezogenen Kosten (zuzüglich einer Durchführungspauschale von 10 Prozent dieser Kosten) und den erzielten Einnahmen. Anders ausgedrückt: Sind Kosten und Durchführungspauschale der Veranstaltung bereits durch die Ticketeinnahmen gedeckt, so wird keine Wirtschaftlichkeitshilfe ausbezahlt. Die Wirtschaftlichkeitshilfe ist grundsätzlich bei 100.000 Euro pro Veranstaltung gedeckelt. Zudem ist eine Obergrenze für solche Veranstaltungen vorgesehen, die regulär am selben Veranstaltungsort wiederholt werden (bspw. Filmvorführungen in Kinos).
Beispiel A: Eine Veranstalterin verkauft 400 Tickets, zu je 50 Euro. Die Corona-bedingte Kapazitätsgrenze beträgt 1000 Teilnehmer*innen (normalerweise wären 2.000 möglich). Die Wirtschaftlichkeitshilfe würde dann 20.000 Euro betragen (entspricht einer Verdopplung der Ticketeinnahmen: 400*50 Euro), sofern die Förderhöchstgrenze nicht erreicht wird. Wann die Förderhöchstgrenze erreicht ist, hängt von den Kosten der Veranstaltung ab. Angenommen die Kosten der beschriebenen Veranstaltung betragen 30.000 Euro, so würde sich die Förderhöchstgrenze auf 13.000 Euro belaufen: Die veranstaltungsbezogenen Kosten von 30.000 Euro zuzüglich einer 10 % Durchführungspauschale beliefen sich auf 33.000 Euro. Aus dem Ticketverkauf wurden 20.000 Euro erzielt. Die Finanzierungslücke beträgt also 13.000 Euro, was die maximale Förderung darstellt. Damit beträgt die Wirtschaftlichkeitshilfe in diesem Beispiel 13.000 Euro).
Beispiel B: Eine Veranstaltungsagentur verkauft 1.200 Tickets zu je 50 Euro. Die Corona-bedingte Kapazitätsgrenze beträgt 1.200 Teilnehmer*innen (normalerweise wären 2.400 möglich). Die Wirtschaftlichkeitshilfe würde dann 50.000 Euro betragen (entspricht einer Verdopplung der Einnahmen aus den ersten 1.000 Tickets: 1.000*50 Euro), sofern die Förderhöchstgrenze nicht erreicht wird.
Sind die Hygieneauflagen noch strenger und wird die mögliche Teilnehmerzahl auf unter 25 Prozent der Maximalauslastung begrenzt, dann sind auch die Zuschüsse höher. In diesem Fall werden die Einnahmen aus den ersten 1.000 Tickets verdreifacht. Auch hier wird eine Überförderung durch eine entsprechende Förderhöchstgrenze verhindert.
Beispiel C: Ein Veranstalter verkauft 280 Tickets zu je 40 Euro. Die Corona-bedingte Kapazitätsgrenze beträgt 300 Teilnehmer*innen (normalerweise wären 1.300 möglich). Die Wirtschaftlichkeitshilfe würde dann 22.400 Euro betragen (entspricht einer Verdreifachung der Ticketeinnahmen: 280*2*40 Euro), sofern die Förderhöchstgrenze nicht erreicht wird.
Zusätzliche Förderung von hybriden Veranstaltungen
Es ist das Ziel der Bundesregierung, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an Kulturveranstaltungen teilnehmen können, zumindest virtuell. Deshalb sollen entsprechende Live-Stream- und andere ergänzende Videoangebote zusätzlich gefördert werden. Wird die Veranstaltung durch ein entsprechendes Online-Angebot ergänzt, beträgt die zusätzliche Kostenerstattung 5 Prozent der Wirtschaftlichkeitshilfe, mindestens jedoch 250 Euro und maximal 5.000 Euro. Auch hier gilt die oben beschriebene Förderhöchstgrenze.
Möglichkeit der Bündelung mehrerer kleiner Veranstaltungen
Um ein wirtschaftliches Antragsverfahren zu gewährleisten, muss die Förderung in der Wirtschaftlichkeitshilfe mindestens 1.000 Euro pro Antrag betragen. Um diese Bagatellgrenze zu erreichen, können mehrere kleinere Veranstaltungen zusammen registriert und beantragt werden.
Ausfallabsicherung für Veranstaltungen bis 2.000 Personen
Auch für Veranstaltungen mit bis zu 500 bzw. 2.000 Besucherinnen und Besucher soll es eine integrierte Ausfallabsicherung eines Teils der tatsächlich angefallenen Ausfallkosten geben für den Fall, dass Corona-bedingt eine für die Wirtschaftlichkeitshilfe registrierte Veranstaltung nicht stattfinden kann.
Beantragung der Wirtschaftlichkeitshilfe
Die Beantragung erfolgt über die Kulturministerien der Länder bzw. die von ihnen beauftragten Stellen. Eine Beantragung und Bewilligung findet erst nach der Veranstaltung statt. Vor der Veranstaltung muss die Veranstaltung jedoch registriert werden. Dabei ist auch ein Hygienekonzept, die geplante Auslastung sowie die Maximalauslastung des Veranstaltungsorts anzugeben. Antragsberechtigt sind nur Veranstalterinnen und Veranstalter; also entscheidend hierbei ist, wer das wirtschaftliche und organisatorische Risiko der Kulturveranstaltungen trägt. Nach der Veranstaltung müssen die Ticketeinnahmen sowie die relevanten Kosten nachgewiesen werden.
Ausfallabsicherung
Größere Veranstaltungen sind typischerweise profitabler als kleinere Veranstaltungen und deshalb nicht vergleichbar auf eine Wirtschaftlichkeitshilfe angewiesen. Allerdings ist bei größeren Veranstaltungen das finanzielle Risiko einer Absage oder Verschiebung der Veranstaltung hoch. Außerdem erfordern größere Veranstaltungen eine intensive Planung und Logistik und haben deshalb eine lange Vorlaufzeit, was die Unsicherheit zusätzlich erhöht.
Trotz dieser Unsicherheit sollen auch große Kulturveranstaltungen, wie zum Beispiel größere Konzerte oder Festivals, wieder geplant und durchgeführt werden können. Deshalb ist für Kulturveranstaltungen mit mehr als 2.000 Besucherinnen und Besuchern eine Ausfallabsicherung vorgesehen, die den Veranstalterinnen und Veranstaltern dieses hohe Risiko zumindest teilweise abnimmt. Dies geschieht dadurch, dass für ab dem 1. September 2021 durchgeführte Veranstaltungen aus dem Sonderfonds Ausfall- oder Verschiebungskosten bezuschusst werden, sollte eine geplante Veranstaltung pandemiebedingt gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden können.
Wie hoch ist die Absicherung?
Im Falle einer pandemiebedingten Absage, Teilabsage oder Reduzierung der Teilnehmerzahl oder einer Verschiebung übernimmt der Ausfallfonds maximal 80 Prozent der dadurch entstandenen Kosten. Die maximale Entschädigungssumme beträgt 8 Millionen Euro pro Veranstaltung. Bei Teilabsagen oder Reduzierung der Teilnehmerzahl werden die erzielten veranstaltungsbezogenen Einnahmen von den Ausfallkosten abgezogen. Bezuschusst wird also nur der betriebswirtschaftliche Verlust.
Welche Kosten sind förderfähig?
Ähnlich wie bei der Überbrückungshilfe III gibt es eine Liste förderfähiger Kosten. Dazu zählen zum Beispiel allgemeine Betriebskosten, Kosten für Personal, Anmietung, Wareneinsätze, Gagen für Künstlerinnen und Künstler, beauftragte Dienstleister etc. Dieselben Kosten können grundsätzlich nur einmalig gefördert werden. Kosten können auch dann geltend gemacht werden, wenn sie vor der Antragstellung angefallen sind.
Transparenz für die Kulturschaffenden
Künstlerinnen und Künstler, Technikerinnen und Techniker, Zuliefernde, Caterer und andere mögliche Vertragspartnerinnen und Vertragspartner sollen aktiv über die Absicherung informiert werden, damit auch sie über die geänderte Risikosituation Bescheid wissen. Deshalb sollen Veranstalterinnen und Veranstaltern den Status einer für die Ausfallabsicherung registrierten Veranstaltung gegenüber Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern stets offenlegen.
Registrierung für die Ausfallabsicherung
Die Veranstalterinnen und Veranstalter registrieren die Veranstaltung vor der geplanten Durchführung auf der vom Bund finanzierten IT-Plattform der Länder und legen dabei auch eine Kostenkalkulation vor. Tritt der Schadensfall tatsächlich ein, wird die Förderung beantragt. Die konkreten Verluste und damit verbundene Kosten werden dabei von dem Veranstalter oder der Veranstalterin nachgewiesen und von prüfenden Dritten bestätigt. Die Verwaltung und Abwicklung erfolgt durch die Länder.
4. Rolle der Länder in der Umsetzung und Einrichtung eines Lenkungsausschusses
Die Kulturministerien der Länder verantworten in ihrem jeweiligen Land die administrative Umsetzung des Bundesprogramms. Eine dezentrale Antrags- und Bearbeitungsstruktur soll sicherstellen, dass das regional unterschiedliche und vielfältige kulturelle Geschehen am besten abgebildet wird. Die Länderkulturbehörden sind zuständig für die Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Finanzhilfen. Außerdem wird von den Ländern die bundesweit einheitliche IT-Infrastruktur zur Beantragung der Finanzhilfen administriert (www.sonderfonds-kulturveranstaltungen.de). Ferner betreiben die Länder eine Beratungshotline (Tel.: 0800 6648430). Die konkrete Verwaltungsabwicklung ist in einer Verwaltungsvereinbarung und verbindlichen Vollzugshinweisen zwischen Bund und Ländern geregelt.
Für den „Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen“ wurde ein Lenkungsausschuss unter Vorsitz der BKM eingerichtet. Diesem Gremium gehören neben der BKM Vertreterinnen und Vertreter des BMF sowie der Länder an. Weiteres Mitglied ist der Deutsche Kulturrat (DKR), um eine passgenaue Abstimmung und Kommunikation mit der Kulturbranche sicherzustellen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützt fachlich die Arbeit des Lenkungsausschusses aufgrund seiner Zuständigkeit für die Überbrückungshilfe III. Die Aufgaben des Lenkungsausschusses umfassen unter anderem die Kontrolle der Abgrenzung der Fondsmittel von anderen Hilfsinstrumenten des Bundes, die Begleitung notwendiger Anpassungen bei der Umsetzung des Programms sowie die breite Kommunikation des Sonderfonds in der Kulturszene.
Anlage :Anlage_LFB_BKM BMF_Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen.pdf